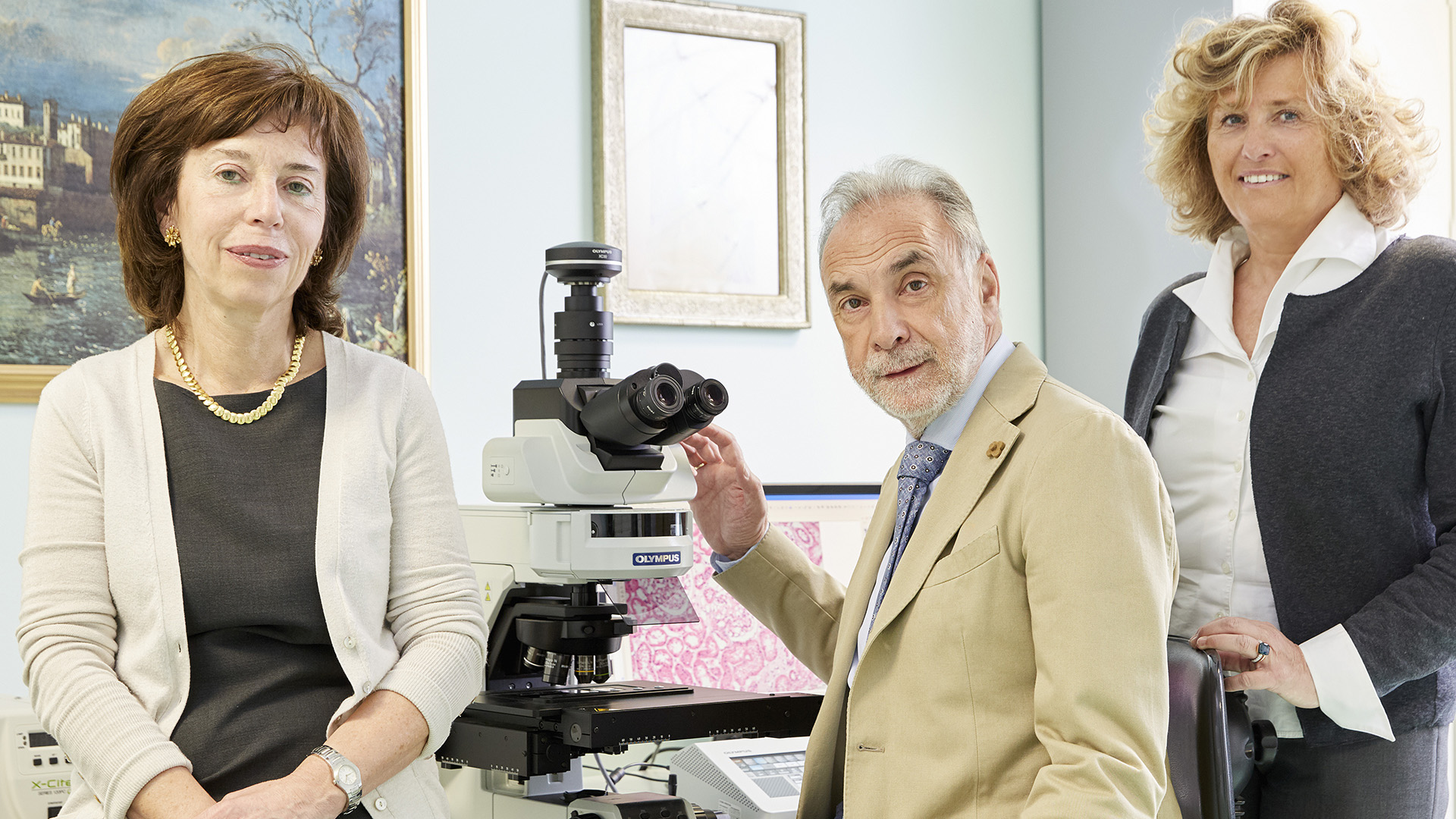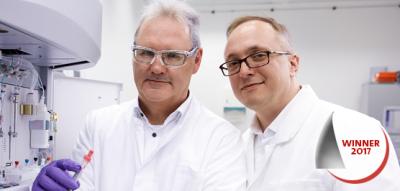Giuseppe Remuzzi, Carlamaria Zoja and Ariela Benigni
ACE-Hemmer zur Verhinderung des Fortschreitens der chronischen Nierenerkrankung (CKD)
Finalisten für den Europäischen Erfinderpreis 2017
Mehr als 200 Millionen Menschen leiden an der chronischen Nierenerkrankung (CKD). Obwohl ein einfacher Test bereits in einem frühen Stadium auf die Krankheit hinweisen kann - ein erhöhter Proteinspiegel im Urin deutet auf eine eingeschränkte Nierenfunktion hin - suchen viele Patienten erst dann ärztliche Hilfe, wenn die Symptome bereits weit fortgeschritten sind. In diesem Stadium waren Ärzte meist nicht mehr in der Lage, das Fortschreiten der Erkrankung - oder eine Nierenentzündung nach einer Organtransplantation - aufzuhalten und ein Organversagen, und damit die lebenslange Angewiesenheit auf die Dialyse, zu verhindern.
Dank der von Remuzzi, Zoja und Benigni entwickelten Medikamente ist die Dialyse inzwischen nicht mehr unabwendbar. Der Durchbruch für das Team kam Ende der 1980er-Jahre, nachdem Remuzzi die nierenrettenden Eigenschaften bestimmter Enzyminhibitoren entdeckt hatte. Diese Inhibitoren, die üblicherweise zur Behandlung von Bluthochdruck eingesetzt werden, lieferten den Schlüsselmechanismus, der den patentgeschützten Medikamenten des Teams, die zwischenzeitlich weltweit zu den Standardtherapien für CKD zählen, zugrunde liegt.
Gesellschaftlicher Nutzen
Die auf ACE-Hemmern basierenden Medikamente des Teams waren nicht nur die ersten, die das Fortschreiten der CKD verhinderten, sondern sie erwiesen sich auch bei der Behandlung der diabetischen Nephropathie - einer Komplikation, von der bis zu 35 Prozent der Diabetiker betroffen sind, - als wirksam. Eines der wichtigsten Medikamente des Teams, Losartan, kommt ganz gezielt organtransplantierten Patienten zugute, denn 21 Prozent der Empfänger von Darm- sowie 18 Prozent der Empfänger von Lebertransplantaten sind von CKD betroffen. Das Medikament ermöglicht es diesen Menschen, wieder gesund zu werden und ein selbstständiges Leben zu führen.
Auch in Entwicklungsländern, in denen Betroffene häufig keinen Zugang zu Dialyse haben und Prävention daher umso wichtiger ist, leisten die Medikamente sehr wertvolle Dienste. Remuzzi hat eine internationale Wohltätigkeitsorganisation, das "Global Advancement Nephrology Project", ins Leben gerufen, um den Menschen in armen Gegenden Zugang zu Früherkennung und erschwinglicher Behandlung von Nierenkomplikationen zu verschaffen.
Remuzzi ist auch ein Verfechter von Vorsorgeuntersuchungen: "Das Herz schlägt, die Lunge atmet - die Nieren machen keinerlei Geräusche, und daher stehen Menschen oft plötzlich vor der Tatsache, dass sie an einer Nierenerkrankung im Endstadium leiden, obwohl sie nie bemerkt haben, dass etwas nicht in Ordnung ist", sagt er. Dabei lässt sich eine Störung der Nierenfunktion mit einem simplen Urintest erkennen, und dann kann eine Behandlung beginnen, bevor die Schädigung irreversibel wird.
Wirtschaftlicher Nutzen
In den 1990er-Jahren arbeiteten Remuzzi und sein Team ganz gezielt an der Entwicklung von ACE-Hemmer-basierten Medikamenten zur Behandlung der Nierenerkrankung. Losartan, das von dem Pharmaunternehmen Merck auf den Markt gebracht wurde, erhielt 1995 sowohl in den USA als auch in der EU die Zulassung für die Anwendung zur Behandlung von Komplikationen im Zusammenhang mit Organtransplantationen. 2011 war der Jahresumsatz mit Losartan auf fast 1,5 Mrd. EUR geklettert. Ein anderes Medikament des Teams, Irbesartan, wurde 1997 zugelassen. Es wird von Sanofi vermarktet. 2015 lag der mit diesem Medikament erzielte Umsatz bei rund 775 Mio. EUR.
Marktanalytiker von BCC Insights bezifferten den US-Markt für Arzneimittel zur Behandlung von Nierenversagen 2016 auf 36 Mrd. EUR. Sie gehen davon aus, dass er bis 2021 einen Wert von 41,7 Mrd. EUR überschritten haben wird. Der globale Umsatz mit Enzyminhibitoren - darunter auch die ACE-Hemmer des Teams - betrug 2016 nahezu 117 Mrd. EUR.
Als Forschungskoordinator beim Mario-Negri-Institut für pharmakologische Forschung in Bergamo regt Remuzzi "seine" Wissenschaftler dazu an, Forschung im Dienste der Wissenschaft zu betreiben. Das Institut wurde 1963 in Mailand als nicht gewinnorientierte Forschungseinrichtung gegründet. Die Außenstelle in Bergamo wurde geschaffen, um die Forschung im Bereich der sogenannten seltenen Krankheiten ("orphan diseases") voranzutreiben. Diese werden von Pharmaunternehmen häufig als "nicht einträglich genug" vernachlässigt. Das Institut meldet nicht selbst Patente an, sondern erlaubt anderen Unternehmen, seine Forschungsergebnisse patentieren zu lassen.
Funktionsweise
Bereits in den 1890er-Jahren erkannten Ärzte, dass erhöhte Proteinwerte im Urin von Patienten auf eine fortschreitende Nierenerkrankung hindeuten können. Ein hoher Proteinspiegel ist ein Anzeichen dafür, dass die glomeruläre Filtrationsrate niedriger wird. Diese ist ein Maß für die Fähigkeit der Nieren, das Blut zu filtern.
Nach zehn Jahren Forschung machte Remuzzi eine entscheidende Entdeckung: Erhöhter Proteinverkehr zu den Nieren ist nicht einfach nur ein Symptom einer Nierenerkrankung, sondern eine Ursache. Wird den Nieren dauerhaft mehr Protein zugeführt, schreitet die Schädigung fort.
Diese Erkenntnis veranlasste Remuzzi dazu, nach einem "Ausschalter" zu suchen, mit dem sich die Progression der Nierenerkrankung aufhalten lässt, bevor sie zum Nierenversagen führt. Und genau diesen fand er in den ACE-Hemmern. Es war bereits bekannt, dass man mit dieser Gruppe von Medikamenten Bluthochdruck verringern konnte - eine häufige Komplikation, von der 70 Prozent der Empfänger von Lungen-, Herz- und Lebertransplantaten betroffen sind.
Remuzzi fand heraus, dass der Wirkmechanismus der ACE-Hemmer den Proteinspiegel im Blut senkt, und dies wiederum stoppt das Fortschreiten der Nierenerkrankung. Er entwickelte ACE-Präparate zu Arzneimitteln weiter, die ganz gezielt für die Behandlung der Nierenerkrankung eingesetzt werden. Sie blockieren die Angiotensin-II-Typ-1-Rezeptoren.
Die Erfinder
Nachdem Giuseppe Remuzzi 1974 an der Universität Pavia sein medizinisches Studium abgeschlossen hatte, begann er am Krankenhaus von Bergamo mit Patienten zu arbeiten, die an der chronischen Nierenerkrankung (CKD) litten, sowie mit organtransplantierten Patienten. Die Veröffentlichung seiner Forschungsergebnisse zum hämolytischen Urämiesyndrom (einer bekannten Ursache der CKD) und zur Nierenersatztherapie in The Lancet im Jahr 1977 brachte ihm internationale Anerkennung ein. Seither gilt er als Kapazität auf seinem Gebiet.
Heute ist er Professor für Nephrologie an der Universität Mailand. Seit 1996 leitet er die Abteilung für Immunologie und klinische Transplantation, seit 2011 die medizinische Abteilung des Krankenhauses von Bergamo. Seit 1999 ist er außerdem Direktor der Abteilung für Nephrologie und Dialyse am "Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII" in Bergamo. Bereits 1984 war er Forschungskoordinator am Mario-Negri-Institut für pharmakologische Forschung in Bergamo geworden.
Im Laufe seiner nunmehr fast vier Jahrzehnte umspannenden Forschungslaufbahn hat Remuzzi etwa 1 300 wissenschaftliche Artikel geschrieben oder mitverfasst. Unter den zahlreichen Preisen, die er erhalten hat, sind beispielsweise der "Jean Hamburger Award" (2005) der Internationalen Gesellschaft für Nephrologie (ISN), der "John P. Peters Award" (2007) sowie der "AMGEN Award" der ISN (2011) zu nennen.
Carlamaria Zoja und Ariela Benigni studierten beide Biologie an der Universität Mailand und promovierten an der Universität Maastricht. Zoja arbeitet seit 1985 als Wissenschaftlerin und Forscherin am Mario-Negri-Institut in Bergamo. Dort leitet sie heute das Labor für Pathophysiologie und experimentelle Forschung zur Nierenerkrankung und Wechselwirkungen mit anderen Organsystemen in der Abteilung für molekulare Medizin.
Ariela Benigni kam 1986 ans Mario-Negri-Institut in Bergamo und leitet dort inzwischen die Abteilung für molekulare Medizin. Als ausgewiesene Expertin in der Frage, welche Rolle Blutdruck und Proteine bei der fortschreitenden Nierenerkrankung spielen, hat sie über 270 Artikel veröffentlicht, die einem "Peer Review" unterzogen wurden. Außerdem hat sie Vorträge auf mehr als 140 nationalen und internationalen Kongressen gehalten. Ihr wurde der "Citta di Bergamo Merit Award" verliehen, und auch die Weltgesundheitsorganisation hat Benigni schon als führende Expertin für die fortschreitende Nierenerkrankung zurate gezogen.
Wussten Sie das?
Eigentlich gilt in der pharmazeutischen Forschung von jeher die Devise: "One drug for one disease" - "Ein Medikament für eine Krankheit". Aber Remuzzi entdeckte, dass ACE-Hemmer, die ursprünglich zur Behandlung von Bluthochdruck entwickelt worden waren, auch in der Therapie von Nierenkrankheiten hilfreich waren. Damit gehören die ACE-Hemmer nun zu einer kleinen Gruppe von Arzneimitteln, die für die Behandlung einer bestimmten Krankheit entwickelt wurden, aber auch in der Therapie anderer Krankheiten eingesetzt werden können (häufig sogar ohne dass die Zusammensetzung wesentlich verändert werden muss).
Andere Beispiele sind Tamoxifen (das in der Brustkrebstherapie eingesetzt wird, aber auch bei bipolaren Störungen helfen kann), Gabapentin (das zur Behandlung von Epilepsie entwickelt wurde und nun als Schmerzmittel verwendet wird), Raloxifen (zur Behandlung von Osteoporose und zur Vorbeugung von Brustkrebs) und sogar Aspirin (ein Schmerzmittel, das auch präventiv gegen Herzerkrankungen wirkt).
Bekannte Arzneimittel für neue Anwendungsgebiete einzusetzen, bietet enorme Vorteile: Sie haben bereits ein Zulassungsverfahren durchlaufen; die hohen Kosten für Tierversuche und klinische Studien fallen daher weg. In der pharmazeutischen Forschung zeichnet sich zunehmend ein Trend ab, vorhandene Arzneimittel "umzuwidmen".
Media gallery
Kontakt
Fragen zum Europäischen Erfinderpreis und zum Young Inventors Prize:
european-inventor@epo.org Erfinderpreis Newsletter abonnierenMedienanfragen:
Kontaktieren Sie unser Presse-Team#InventorAward #YoungInventors